Wenn es darum geht, Kinder an die weite und gefahrenhaltige Welt der Medien heranzuführen, sind Eltern wie Schulen gefordert, um die Medienkompetenz der jungen Generation zu fördern. Gerade da das Smartphone in immer jüngeren Händen ist.
Die Türe des Kinderzimmers schliesst sich und gleichzeitig öffnet sich für das Kind am Smartphone eine Welt voller Gefahren, Falschinformationen und Menschen mit unmoralischen Absichten. Ganz so düster mag sich die Situation für Eltern nicht präsentieren, wenn die Kinder mit elektronischen Geräten hantieren. Und doch ist es für Erziehungsberechtigte eine Herausforderung, den Medienkonsum ihrer Kinder zu begleiten, zumal sich dieser im Verlaufe der Jahre bis ins Teenageralter und darüber hinaus stark verändert.
Während es im Vorschulalter primär die Bildschirmzeiten zu monitoren gilt, werden die Aufgaben der Eltern schon bald um zusätzliche Faktoren ergänzt. Dies nicht zuletzt deswegen, da die Kinder und Jugendlichen im Schnitt immer jünger werden, wenn sie ihr erstes Smartphone erhalten, in der Schweiz heute meist im Alter von 9 bis 10 Jahren. Gemäss der MIKE-Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) besitzt mehr als die Hälfte der Kinder mit zehn Jahren ein eigenes Gerät. Schon zu Beginn der Primarschule, im Alter von 6 bis 7 Jahren, hat rund ein Fünftel ein eigenes Handy, gegen Ende der Primarschule mit 12 bis 13 Jahren sind es rund 79 Prozent.
Mit den mannigfaltigen Möglichkeiten, die das Smartphone bietet, sind die Erziehungsberechtigten entsprechend auf inhaltlicher Ebene gefordert, wobei diesbezüglich eine Kontrolle noch deutlich schwerer fällt als rund um die Bildschirmzeit. Wie so oft bilden Kommunikation und Prävention in diesem Zusammenhang entscheidende Schlüssel für einen verantwortungsvollen Medienumgang. Kinder schauen zu ihren Eltern hinauf, orientieren sich in ihrem Verhalten an ihnen – so auch bei der Mediennutzung.
«Mama, nicht immer aufs Handy schauen»
Mit anderen Worten, ein bewusster, reflektierter Umgang der Erwachsenen mit Medien bildet die beste Grundlage für eine gesunde Medienerziehung. Wer täglich stundenlang vor dem Bildschirm sitzt und destruktive Medieninhalte konsumiert, nimmt seine Vorbildfunktion nicht wahr. Dies gilt auch dafür, in welchen Situationen beispielsweise das Smartphone genutzt wird, wie Daniel Süss erklärt. Er ist an der ZHAW Professor für Medienpsychologie und an der Universität Zürich Professor für Kommunikationswissenschaft. «Zum Beispiel kann man bei gemeinsamen Spaziergängen einführen, das Handy bewusst nicht mitzunehmen, um voll präsent zu sein. So vermitteln die Eltern, dass ständige Erreichbarkeit nicht immer erstrebenswert ist.» Im Jugendalter orientierten sich die Kinder dann verstärkt an Gleichaltrigen, wollen mit ihren KollegInnen verbunden bleiben, wie Süss erklärt.
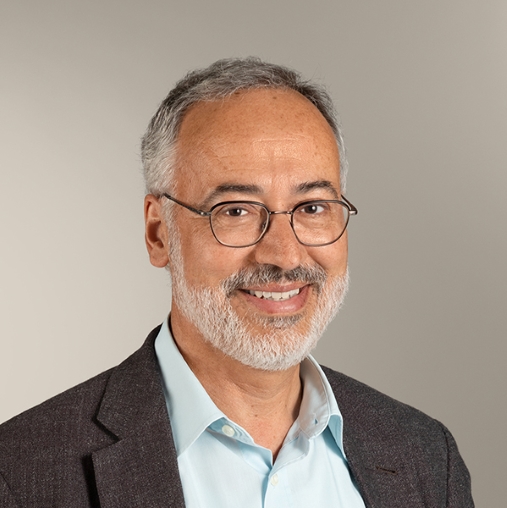
Ein wichtiger Schlüssel bildet zudem die Partizipation des Kindes, sprich: Die Regeln müssen gemeinsam aufgestellt werden, welche es in Bezug auf Medienzeiten, Inhalte und Nutzungsorte altersgerecht festzulegen gilt. Individuelle Bedürfnisse sollten dabei berücksichtigt und die Regeln regelmässig angepasst werden, um der Entwicklung des Sohnes oder der Tochter gerecht zu werden.
Offen über die Lieblingsserie reden
Gerade im Teenageralter teilweise auf Ablehnung stossen mag, den Medienkonsum seines Kindes zu begleiten, doch ist es zentral, ansprechbar zu sein und sich für die genutzten Inhalte zu interessieren. Offene Gespräche über Lieblingssendungen, Apps oder Spiele fördern das gegenseitige Vertrauen und helfen dabei, Erlebnisse gemeinsam zu reflektieren. Die Gespräche müssen sich also keinesfalls ausschliesslich um Risiken drehen, sondern auch um positive Erfahrungen und Herausforderungen in der digitalen Welt. Eigene Medienerfahrungen können dabei geteilt werden, und auch wenn die uncoolen Eltern die Generation Z oder Alpha doch sowieso nicht mehr verstehen mögen, kann einiges davon hängen bleiben.

Gleichzeitig können gewisse Spielregeln rund um die Sicherheit im digitalen Raum nicht ausser Acht gelassen werden. Datenschutz spielt altersunabhängig eine zentrale Rolle und gerade bei jüngeren Kindern ist Unterstützung beim Einrichten von Privatsphäre-Einstellungen und Erklärungen, welche persönlichen Daten geschützt werden sollten, angezeigt. Auch in diesem Zusammenhang hilft eine offene Kommunikation über den Umgang mit Fremden und problematischen Inhalten im Netz, denn dass dieses nie vergisst, mag eine Binsenweisheit sein, ändert jedoch nichts an ihrer Richtigkeit.
Das Weltgeschehen auf TikTok verfolgen
Wir bewegen uns im digitalen Zeitalter, was das bewusste Schaffen medienfreier Zeiten bedingt, um dem endlosen Strom an Informationen und der konstanten Stimulation der Sinne zumindest für einen Moment zu entkommen. Umso wichtiger sind solche Pausen für das kindliche Gehirn, das sich noch in der Entwicklung befindet. So können Pläne für medienfreie Zeiten, beispielsweise während gemeinsamer Mahlzeiten oder vor dem Schlafengehen, erstellt und alternative Aktivitäten wie Sport, Musik oder gemeinsame Ausflüge gefördert werden, um den Stellenwert von Medien im Alltag auszugleichen.
Wie wichtig es ist, sein Kind zu ermutigen, das kritische Denken zu fördern, um Medieninhalte zu hinterfragen, Fake News zu erkennen und eigene Meinungen zu entwickeln, unterstreicht der Fakt, dass sich rund 80 Prozent der Schweizer Jugendlichen heutzutage über Social Media informieren. So zeigen verschiedene Studien, dass Plattformen wie Instagram, TikTok, YouTube und Snapchat für Jugendliche zu den zentralen Informationsquellen mutiert sind.

Derweil verlieren klassische Medien wie Radio, Zeitungen und Fernsehen bei der Nachrichtenbeschaffung immer weiter an Bedeutung, wie unter anderem eine Studie des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich bestätigt. Das Gerät der Wahl ist dabei wenig überraschend das Smartphone, über das News gerne nebenbei oder zufällig konsumiert werden. Dies oftmals in Form kurzer, auf die individuellen Interessen zugeschnittener Inhalte, was wiederum die Kompetenz, Nachrichten in einen grösseren Kontext und unabhängig von Individualinteressen einzuordnen, schmälern kann.
Nicht alles ist echt
Dazu passt auch, dass mittlerweile fast die Hälfte der Schweizer Jugendlichen als «News-Deprivierte» bezeichnet werden, also nur selten Nachrichten konsumieren. Dies hat wiederum zur Folge, dass gesellschaftlich relevante Themen an dieser Zielgruppe vorbeizugehen drohen und die Nachrichtenkompetenz kann darunter leiden, wobei sich in diesem Zusammenhang die Frage nach der Verantwortung stellt.
Süss plädiert in diesem Zusammenhang für ein sinnvolles und sich ergänzendes Zusammenspiel zwischen Schule und Eltern. Innerhalb der Familie stehe dabei die mediale Gestaltung des Alltags im Vordergrund sowie der Austausch über Wertfragen. «Dies ist je nach Weltanschauung oder religiösen Vorstellungen sehr unterschiedlich und liegt nicht im Bereich der Schule.» Ausserdem diene die Familie neben dem Freundeskreis als wichtige Anlaufstelle, wenn Kinder und Jugendliche mit belastenden Medieninhalten und -erfahrungen wie Cybermobbing konfrontiert werden. «Unsere Befragungen haben gezeigt, dass Lehrpersonen in diesem Falle nicht als primäre Ansprechpersonen wahrgenommen werden.»

In der Schule gehe es darum, über die Risiken und Chancen verschiedener Medien(umgangsstile) zu reflektieren und Medienwissen zu vermitteln, wie es der Lehrplan 21 vorsieht. «Zu verstehen, wie publizistische Medien funktionieren oder was vertrauenswürdige Nachrichten sind, sind wichtige Lernziele», erklärt Süss. Auch gelte es für die Kinder, eine Bildlesekompetenz zu entwickeln, gerade nun, da die sichtbaren Unterschiede zwischen echten und KI-generierten Bildern immer kleiner werden.
Ausbrechen aus der eigenen Blase
Süss ist überzeugt davon, dass irgendwann gar kein Unterschied mehr erkennbar sein wird und er glaubt auch nicht, dass es ausreichend sein wird, einen Hinweis zu platzieren, wenn ein Bild KI-generiert ist. «In Zukunft wird es gerade für Kinder und Jugendliche wichtiger sein, grundsätzlich eine vorsichtige bis skeptische Haltung zu haben bei Medieninhalten, die erstaunlich oder aussergewöhnlich erscheinen.» Beim Einsatz von KI zur Lernunterstützung und beim Schreiben von Arbeiten gelte es zu sensibilisieren, wann die künstliche Intelligenz ein sinnvolles Mittel zur Effizienzgewinnung darstellt und wann es zwar eine Abkürzung ist, den Lerneffekt jedoch signifikant verringert.
Mit dem Blick in die Zukunft gerichtet, erwartet Daniel Süss, dass die Frage, welcher Medienumgang einem guttut und welcher eher belastend wirkt, an Bedeutung gewinnen wird. Es gehe darum, einen individuell selbstgesteuerten Ansatz zu finden. «Ausserdem wird es nicht nur im demokratiepolitischen Kontext von grosser Bedeutung sein, den Austausch zwischen verschiedenen Wertehaltungen sowie Toleranz und Vielfalt zu pflegen, da vielerorts Polarisierung und Radikalisierung auf dem Vormarsch sind – verstärkt durch Filterblasen, in denen sich immer mehr Menschen bewegen.» Offenheit gegenüber Neuem sei generell zentral in einer Welt der algorithmusgesteuerten Mediennutzung. Wobei dies freilich nicht nur die junge Generation betrifft.









